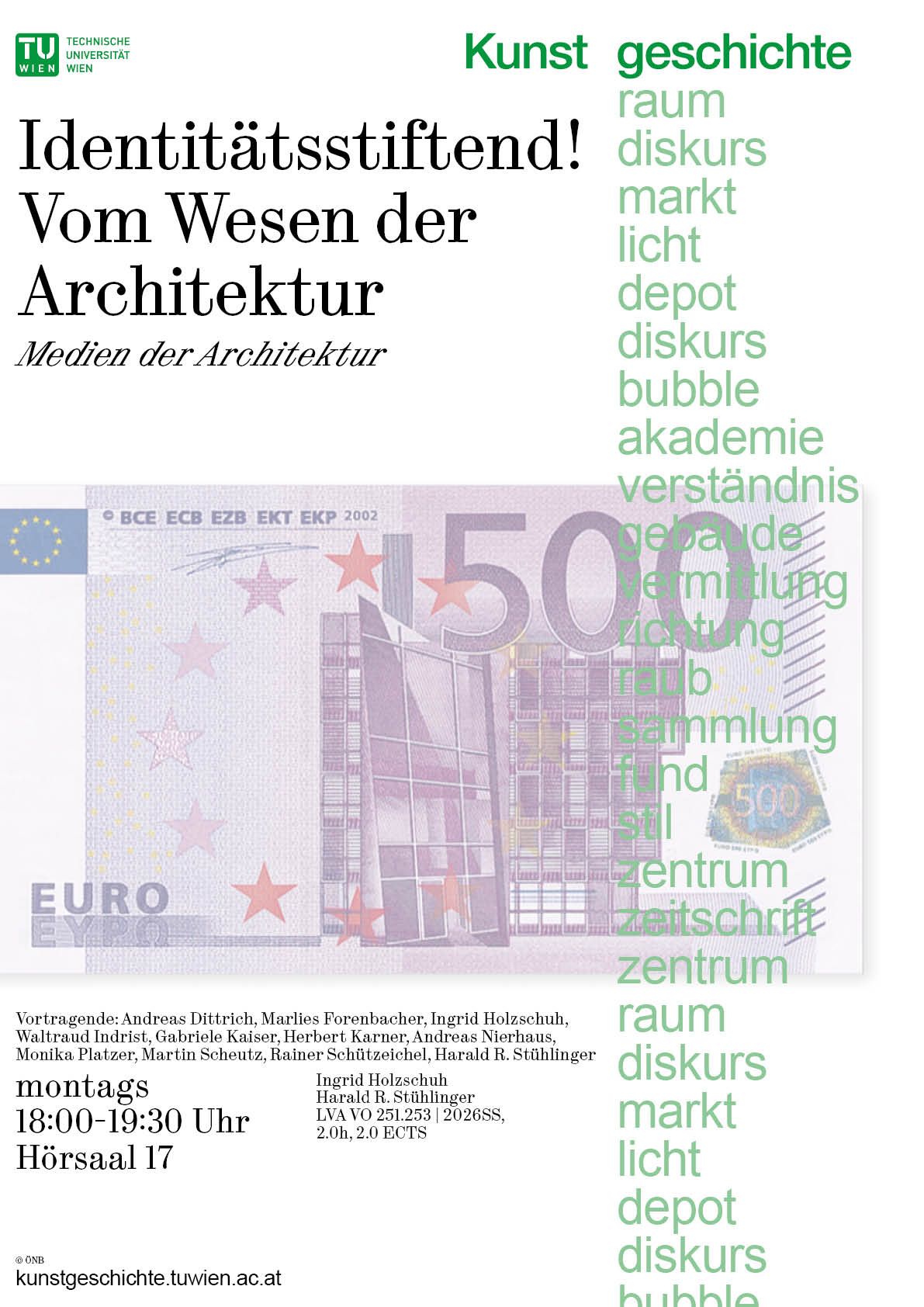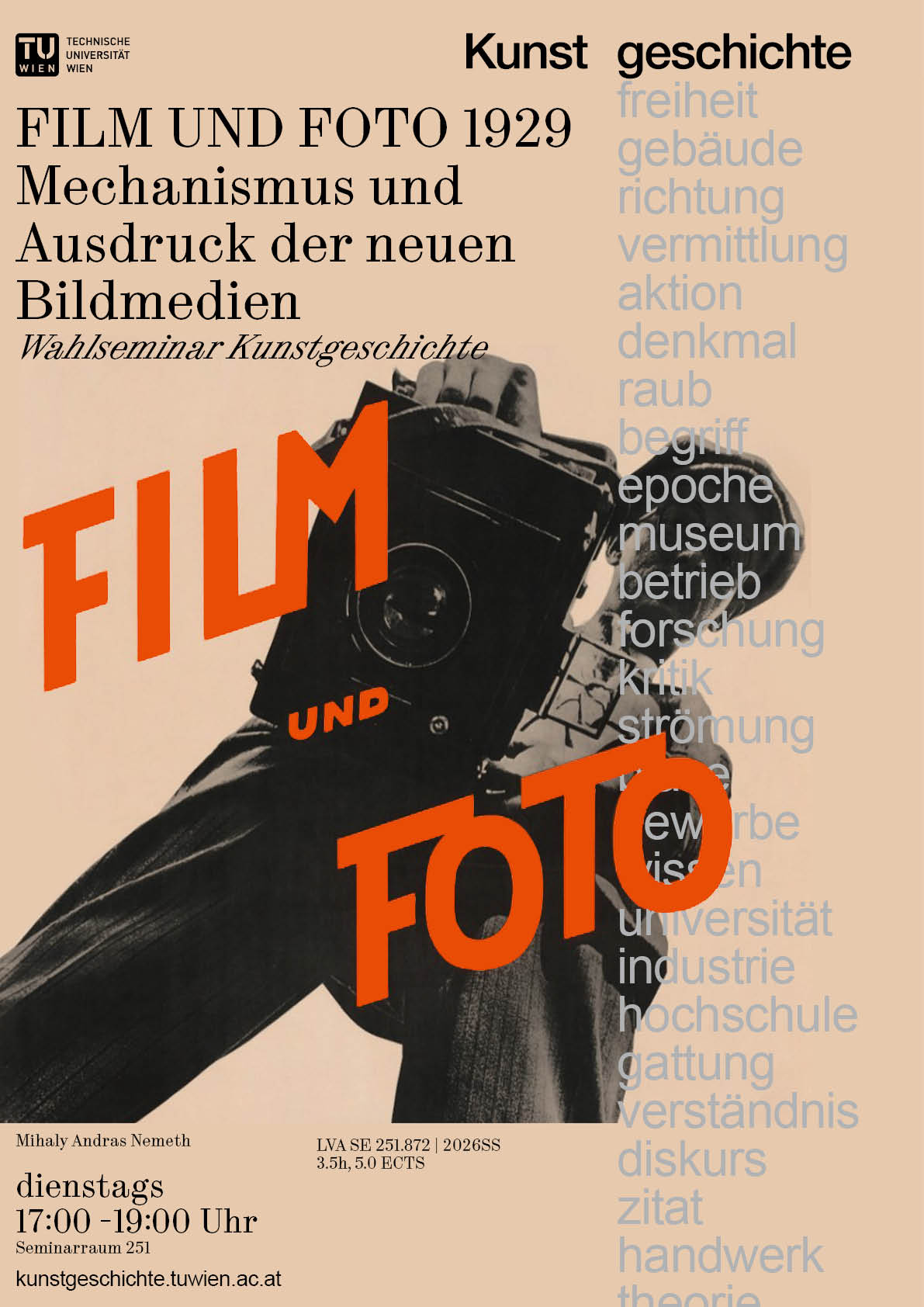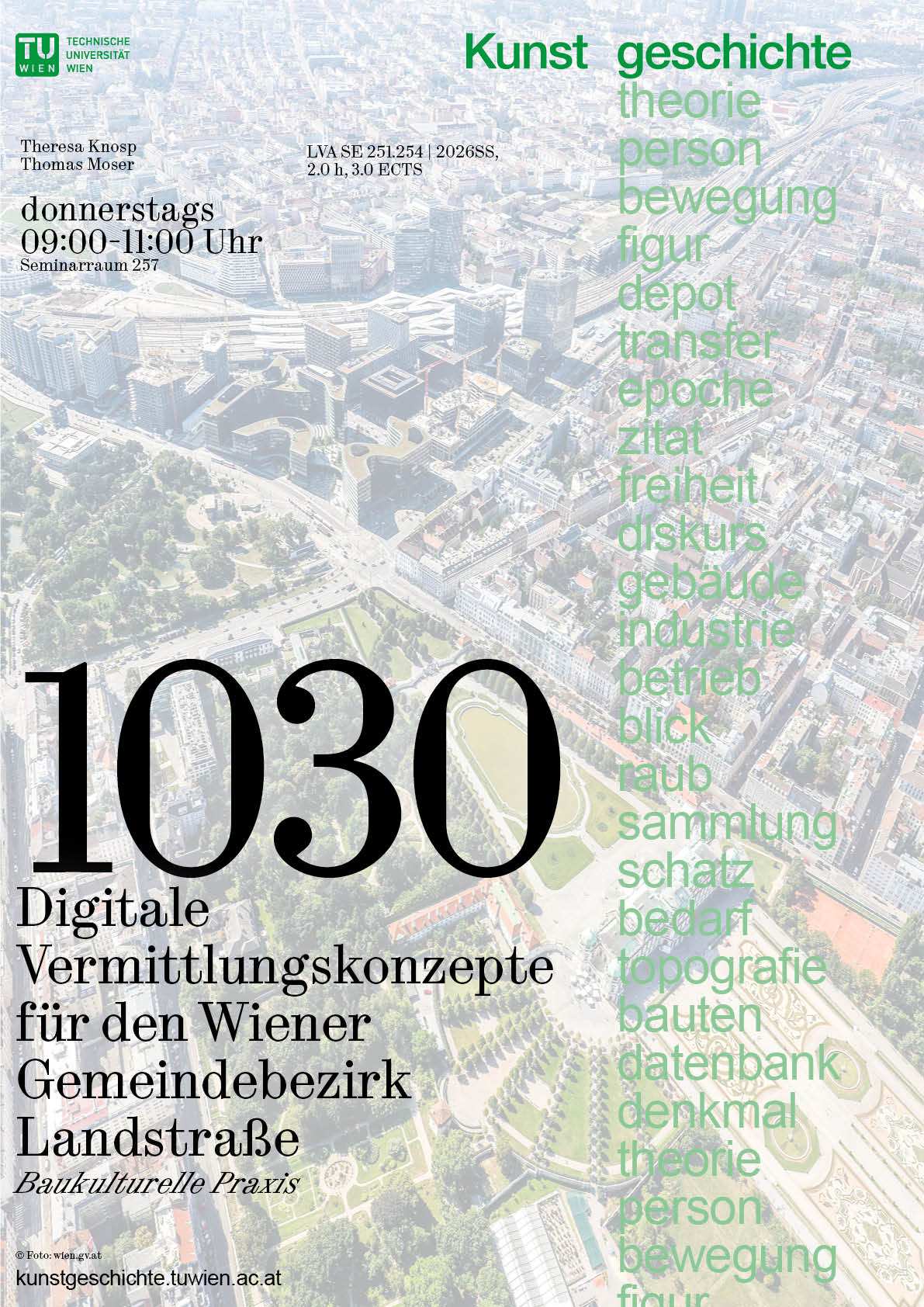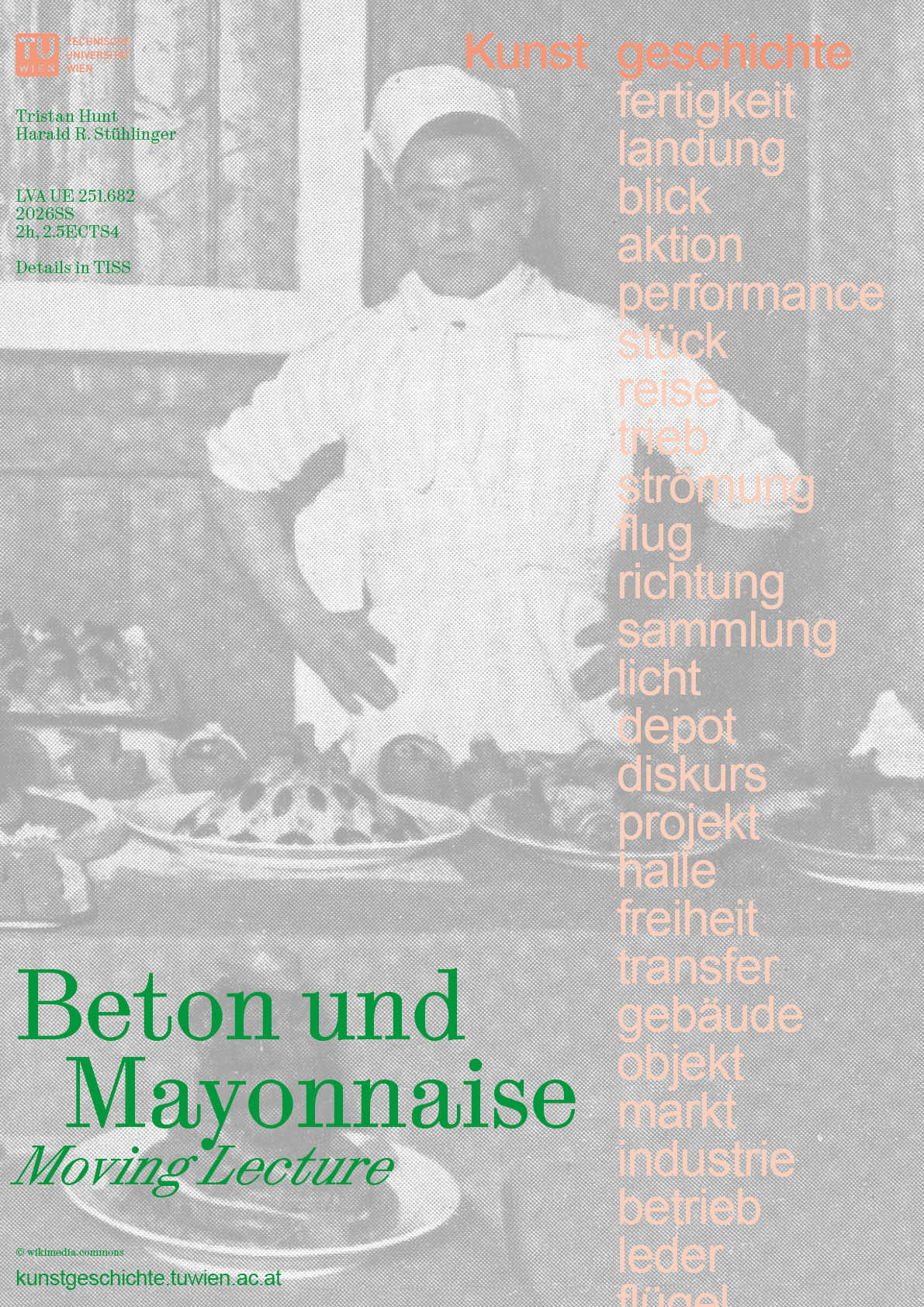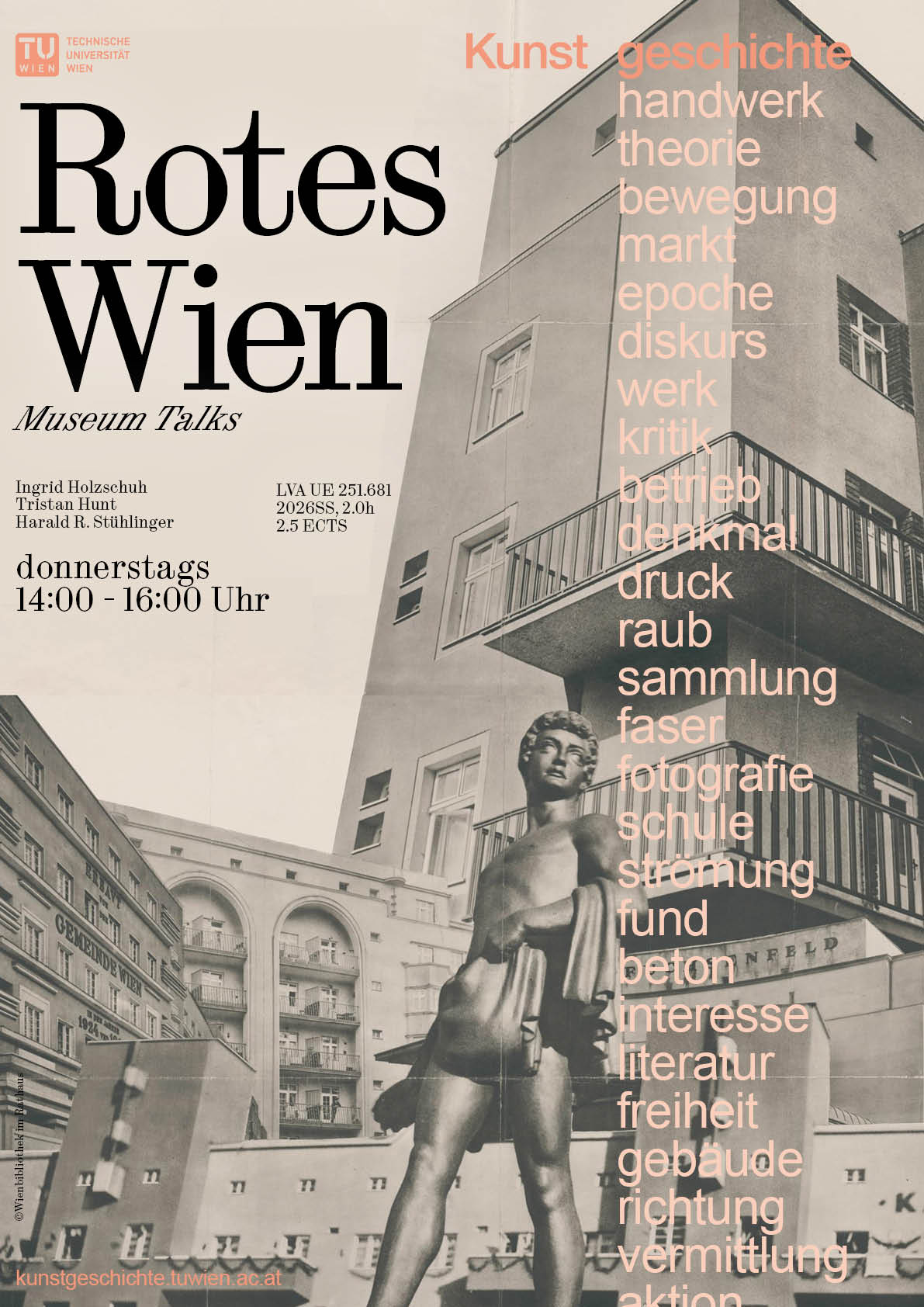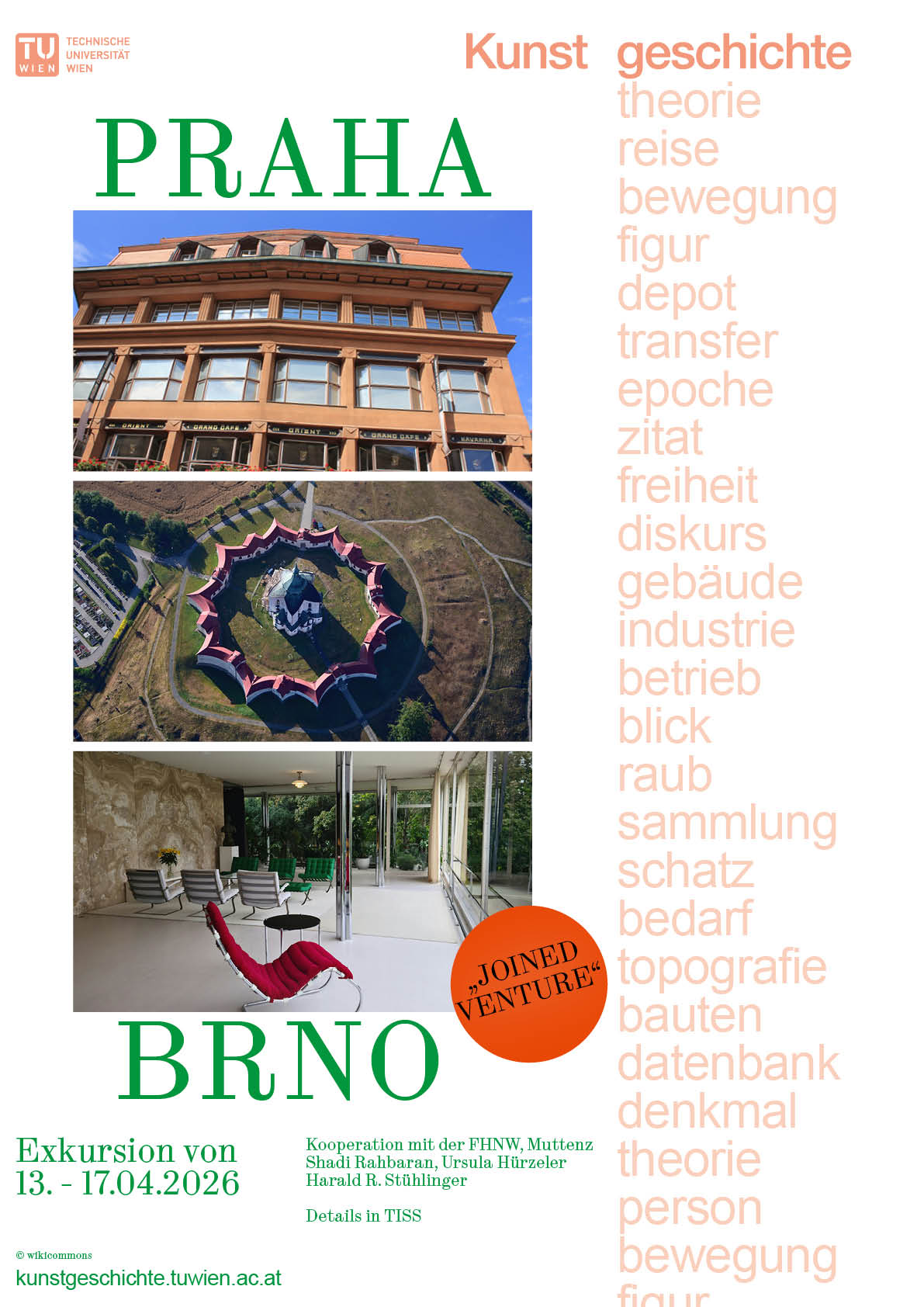VO Architektur- und Kunstgeschichte 2
- Univ.Prof. Dipl.Ing. Mag.phil. Dr.sc.ETH Harald R. Stühlinger
- Univ.Ass.in Dipl.Ing.in Mag.a phil. Theresa Knosp
- Univ.Ass. Dr.phil. Thomas Moser M.A.
- Univ.Ass. Tristan Hunt Dipl.-Ing.
- Univ.Ass. Mihály András Németh M.A.
SS 2026
Merkmale
- Semesterwochenstunden
- 2.0
- ECTS
- 2.0
- LVA Nummer
- 251.867
- Format der Abhaltung
- Präsenz
- Learning outcomes
- Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage,
maßgebliche Themen aus der Geschichte der bildenden Künste - Malerei, Skulptur, Architektur - zu benennen und zu erläutern,
große Zusammenhänge innerhalb der Kunstproduktion zu vergleichen und gegenüberzustellen,
Bauwerke stilistisch einer historischen Epoche zuzuordnen und anhand ihrer Charakteristika zu beschreiben,
aus historischen Quellen und Texten Kernaussagen herauszuarbeiten und in einen vorgegebenen Kontext zu stellen sowie
Fachterimini korrekt anzuwenden.
Content of the course
Artefakte aus der Geschichte (von künstlerischen über architektonischen bis hin zu städtebaulichen) werden durch Beschreibung, Analyse und Interpretationen zu verstehen versucht. Neben dem jeweiligen historischen Kontext wird auf die Wirkungsgeschichte des Artefaktes sowie dessen mediale Präsentation und Repräsentation besonderes Augenmerk gelegtExamination mode
schriftlichPrüfungstermine
BEGINN: 03.03.2026
ENDE : 16.06.2026, (keine VO während der Osterferien, am 14.04.26 und während der Pfingstferien)
ZEIT: jeweils, dienstags, von 09.00 - 11.00h bitte pünktlich
ORT: Informatikhörsaal - ARCH-INF, Treitlstraße 3
ENDE : 16.06.2026, (keine VO während der Osterferien, am 14.04.26 und während der Pfingstferien)
ZEIT: jeweils, dienstags, von 09.00 - 11.00h bitte pünktlich
ORT: Informatikhörsaal - ARCH-INF, Treitlstraße 3